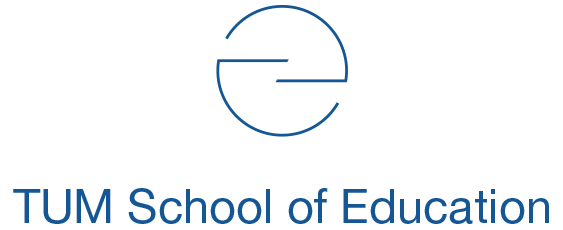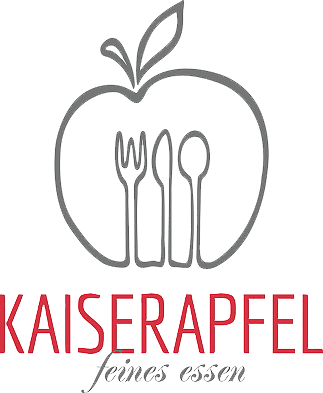Inhaltlich verantwortlich: Schulleitung Gymnasium Penzberg
Kriegsende 1945
Der Leistungskurs Geschichte im Gespräch mit Hans-Günther Hoche
„Moses in Iffeldorf“ – so lautet der Titel des um den 30. Januar 2025 erschienen Buches von Hans-Gunther Hoche über die Evakuierung von ca. 2000 KZ-Häftlingen aus den Todeszügen, die im April 1945 in Oberbayern in Iffeldorf beispielsweise zum Halten kamen.
(Kursleiterin OStRin Michaela Wagner)

Recherche im Stadtarchiv Penzberg
Leistungskurs Geschichte
Im Rahmen eines Kursprojekts zum Ende des Zweiten Weltkriegs und die Ereignisse um die Penzberger Mordnacht vor 80 Jahren beschäftigte sich der Leistungskurs Geschichte des Gymnasiums Anfang Februar 2025 mit der eigenen Lokalgeschichte.
Für die 13 Schülerinnen und Schüler eine andere und neue Lernerfahrung abseits vom Klassenzimmer. Zwar galt es auch hier sich mit Quellenmaterial auseinanderzusetzen, nur mussten sie selbst entscheiden, welche Quellen ergiebig für ihr Projekt sind. Eine nicht ganz leichte Aufgabe angesichts der zahlreichen Dokumente und Facharbeiten. Sehr hilfreich und zuvorkommend hat die Mitarbeiterin des Stadtarchivs, Frau Fohlmeister-Zach, dem Kurs im Vorfeld eine Vorauswahl zur Verfügung gestellt, diese auch gleich in einzelne Schwerpunktthemen unterteilt, damit die Arbeit zielgerichtet erfolgen konnte. Die neu gewonnenen Kenntnisse nahmen die Kursteilnehmenden mit in Ihren Unterricht und in die eigene Projektarbeit.
(Kursleiterin OStRin Michaela Wagner)

„Sophie Scholl – Liebe in Zeiten des Widerstands“
Theaterbesuch des W-Seminars Geschichte
Am Dienstag, den 18. Februar, haben Schülerinnen und Schüler des W-Seminars und des Leistungskurses Geschichte die Theateraufführung „Sophie Scholl – Liebe in Zeiten des Widerstands“ an der LMU in München besucht. Diese stellte dabei auf zugleich tiefst rührende, aber auch höchst tragische Weise den Verlauf der Beziehung zwischen Sophie Scholl und ihrem Geliebten Fritz Hartnagel in der Zeit des NS-Regimes und des Zweiten Weltkrieges dar. Hartnagel war zu jener Zeit Soldat und somit von seiner Partnerin meistens getrennt, weshalb den Zuschauern die Liebesgeschichte hauptsächlich durch das Vorlesen der Briefe, die sich das Paar während jener Zeit schrieb, vermittelt wird. In ihnen zeigen sich politische Aspekte, wie der Widerstand Sophies gegen die NS-Ideologie und die zunehmende Distanzierung des Soldaten Fritz vom Militarismus. Vorherrschend werden aber die Belastungen, welche die damaligen Umstände auf ihr Verhältnis hatten, und die Wege, auf denen sie mit diesen umgingen, behandelt. Einzig in der letzten Viertelstunde, in der die Verhaftung und Hinrichtung von Sophie und Hans Scholl behandelt wird, weicht das Stück dabei von der Form des Briefdialogs ab. Die Zuhörer wechselten von der Großen Aula der LMU in den Lichthof des Gebäudes, dem Originalschauplatz der Geschehnisse, in dem die Geschwister Scholl die Flugblätter gegen das NS-Regime herabregnen haben lassen. Unter dem mystischen Klang der Orgel endete dort das Stück auf sehr emotionale Weise, indem die, über den ihren Tod herausgehende, Loyalität und Verbundenheit Hartnagels mit seiner Verlobten und ihrer Familie dargestellt wird.
Insgesamt ein anderer Ansatz sich mit Widerstand und Empowerment auseinanderzusetzen.
(Lukas Bröker, Q12; Kursleitung Michaela Wagner)